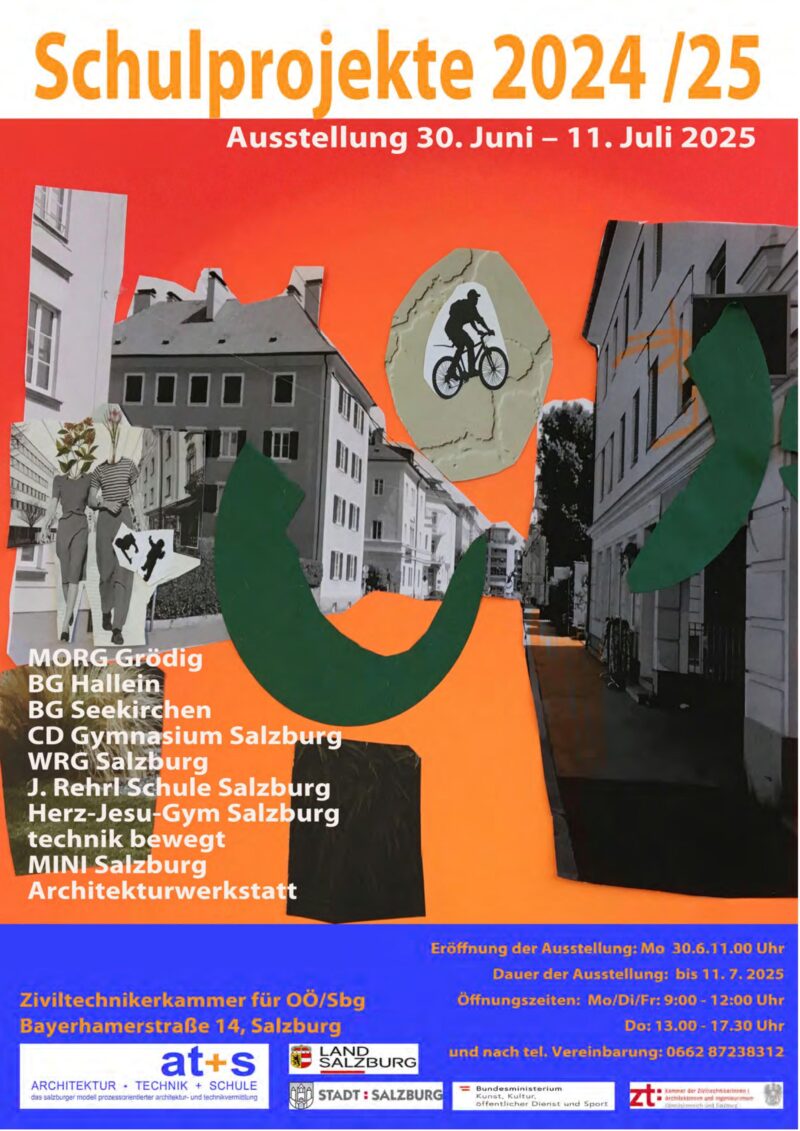Ziel des Projekts der 3K war es, bei den Schülerinnen und Schülern ein tiefgreifendes Bewusstsein für Raumwahrnehmung, Raumgestaltung und partizipative Schulentwicklung zu schaffen. Im Fokus stand die Frage: Wie kann ein Schulraum gestaltet sein, damit er den Bedürfnissen der Lernenden gerecht wird? Dabei wurden pädagogische, gestalterische und demokratische Aspekte miteinander verknüpft.
Die Einführung erfolgte durch eine Vorstellung des Projektziels, der Rahmenbedingungen (Bauplatz) und der Rolle von Raumgestaltung in innovativen Schulkonzepten. Praxisbeispiele zeigten unterschiedliche Ansätze moderner Lernumgebungen.
In einer praktischen Übung – der „Blindführung“ – erlebten die Schülerinnen und Schüler Räume mit geschärften Sinnen. Eine anschließende Reflexion half, subjektive Raumwahrnehmung zu thematisieren.
Eine Exkursion durch das Schulgebäude förderte die bewusste Auseinandersetzung mit Raumeigenschaften wie Licht, Farbe, Materialien und Atmosphäre. Raum wurde dabei als aktiv gestaltendes Element erlebt. Abschließend erstellten die Schülerinnen und Schüler gruppenbezogene Mindmaps zur Erfassung von Raumbedürfnissen und -Wahrnehmungen.

Die Erkenntnisse wurden in Gruppen diskutiert, erste Ideen für eine „Traumschule“ entwickelt und in Form von Plakaten (A1) visualisiert.
In Gruppen entwarfen die Schülerinnen und Schüler erste Raumkonzepte großformatig auf Zeichenrollen. Es wurden Rollen innerhalb der Gruppen verteilt (Projektleitung, Architekturteam, Moderation etc.).
Schließlich wurden die Ideen im Maßstab 1:50 umgesetzt. Dabei wurden Materialien wie Karton, Pappe, Stoffe, Holz und Styropor verwendet. Die Arbeitsweise war experimentell und offen – der kreative Umgang mit Materialien wurde ausdrücklich unterstützt. Besonderes Augenmerk lag auf der Koordination der Gruppen untereinander (z. B. Hauptmaße, Anschlussstellen).
Das Projekt wurde von den Schülerinnen und Schülern mit großem Interesse und Engagement aufgenommen. Besonders hervorzuheben ist die Verknüpfung sinnlicher Erfahrungen mit planerischem Denken. Die intensive Auseinandersetzung mit Raum Fragen förderte sowohl Kreativität als auch demokratisches Verantwortungsgefühl – sie erforderte Selbstorganisation, Abstimmung und Teamfähigkeit.